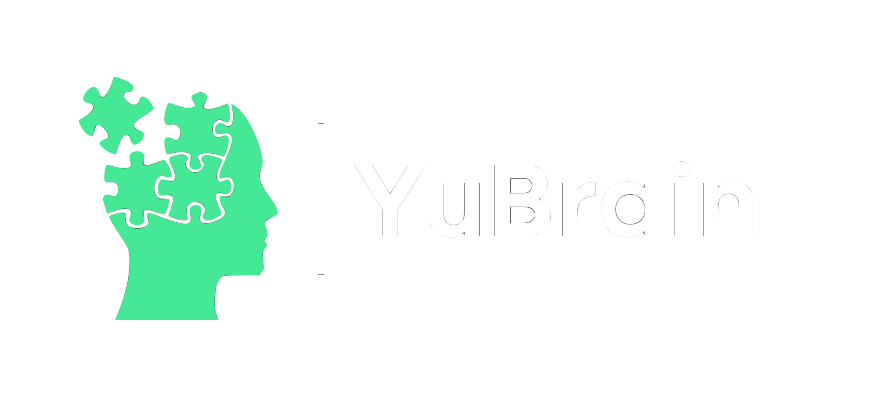Tabla de Contenidos
In jedem kommunikativen Akt gibt es eine Reihe von Operationen, die Teil des argumentativen oder argumentativen Prozesses sind. Diese Prozesse können mittels unterschiedlicher sprachlicher Strukturen durchgeführt werden, die explizit sein können oder nicht. Wenn diese Strukturen nicht explizit sind, sind andere Prozesse erforderlich, um die Argumente zu verstehen. Einer dieser Prozesse ist die Inferenz, und es ist notwendig, zuerst zu verstehen, worum es geht, um zu verstehen, was Sorites sind.
die Schlussfolgerung
Inferenz kann als eine Operation angesehen werden, die eine dynamische Progression von Bekanntem herstellt, um Unbekanntes zuzulassen. Diese Operation, die sowohl beim formalen als auch beim nicht formalen Denken vorhanden ist, kann aus folgenden Gründen stammen:
- Die eigene Erfahrung . Was wir von der Welt haben und nicht durch progressives Denken.
- Empirisches Denken . Was ist progressives Denken innerhalb der eigenen Erfahrung?
- Begründung der exakten Wissenschaften . Was ist progressives Schließen aus Erfahrung?
Die Schlussfolgerungen, die durch logische Regeln oder formales Denken gezogen werden, können hauptsächlich durch zwei Verfahren hergestellt werden: Deduktion und Induktion.
der Abzug
Die Deduktion ist eine Argumentation, die vom Makro zum Mikro geht, dh vom Allgemeinen zum Besonderen, und das Prinzip oder Axiom der Extensionalität respektiert. In diesem Prinzip wird die Gültigkeit des Arguments unabhängig vom Inhalt der Aussagen nachgewiesen. Sein grundlegendes Instrument ist der Syllogismus, der aus drei Sätzen besteht: Der erste ist ein allgemeines Gesetz, das als Hauptsatz bezeichnet wird. Die zweite ist eine besondere Tatsache, die als Untersatz bezeichnet wird. Die dritte ist die Schlussfolgerung, die aus den vorherigen Prämissen abgeleitet wurde, dh aus dem Schluss, der dem Prinzip der Extensionalität folgt.
Das deduktive Denken geht über den formalen Rahmen hinaus durch Syllogismen, die nicht die kanonische Form der drei Sätze annehmen, wie z. B.: die Sorites, das Epiquereme und das Enthymeme.
Sorites
Ein Aspekt der Komplexität der Argumentation besteht darin, dass Argumente aus dem wirklichen Leben oft verwandt sind. Beispielsweise kann die Schlussfolgerung eines Arguments die Prämisse eines anderen sein, sodass eine Reihe von Argumenten als Zeichenfolge verknüpft werden kann. Was die Argumente in einer Kette verbindet, sind die Aussagen, die die Schlussfolgerung eines Arguments in der Kette und die Prämisse des nächsten sind. In einfachen Worten, die Sorites bestehen aus zwei gültigen Prämissen, mit denen daher das Argument gültig ist.
Beispiel: „Tatsache ist, dass zwischen dem Aufstellen der Puppe auf der Ausstellungsplattform und der Entdeckung des Diebstahls nichts und niemand sie berührt hat. Daher konnte die Puppe zwischen dem Zeitpunkt, zu dem die Puppe auf die Plattform gestellt wurde, und dem Zeitpunkt, zu dem der Diebstahl entdeckt wurde, nicht gestohlen worden sein. Daraus folgt einfach und unvermeidlich, dass die Puppe außerhalb dieses Zeitraums gestohlen worden sein muss» (Ellery Queen, The Dauphin’s Doll).
Analysieren eines Kettenarguments
In der vorgestellten Passage gibt es drei Aussagen:
- „Tatsache ist, dass zwischen dem Zeitpunkt, an dem die Puppe auf die Ausstellungsplattform gestellt wurde, und dem Zeitpunkt, an dem der Diebstahl entdeckt wurde, nichts und niemand sie berührt hat.“
- „Zwischen dem Zeitpunkt, an dem die Puppe auf die Plattform gestellt wurde, und dem Zeitpunkt, an dem der Diebstahl entdeckt wurde, konnte die Puppe nicht gestohlen worden sein.“
- „Die Puppe muss außerhalb dieses Zeitraums gestohlen worden sein.“
Auf der anderen Seite gibt es zwei Schlussfolgerungsindikatoren, nämlich „deshalb“ und „daraus folgt … dass“. Dies bedeutet, dass es in der Passage zwei Argumente gibt. Darüber hinaus zeigt die Position der Indikatoren, dass es sich bei den Aussagen 1 und 2 um Schlussfolgerungen handelt. Allerdings ist Aussage 1 nicht markiert, also eine Prämisse, da sie Teil eines der beiden Argumente ist.
Dass die erste Aussage nun eine Prämisse ist, sieht man daran, dass das Argument von 1 bis 2 logisch ist: Wenn in dieser Zeit niemand die Puppe berührt hat, konnte sie damals nicht gestohlen worden sein. Aussage 2 ist aber auch eine Prämisse, weil das Argument von 2 bis 3 logisch ist: Wenn die Puppe zu dieser Zeit nicht gestohlen werden konnte, dann muss sie zu einer anderen Zeit gestohlen worden sein. Schließlich enthält diese Passage also eine Kette von zwei Argumenten, die durch Aussage 2 verbunden sind, die die Schlussfolgerung der ersten und die Prämisse der zweiten ist.
Auswertung des deduktiven Arguments
Diese Passage ist ein Beispiel für die einfachste und gebräuchlichste Art von Kettenargumenten oder Sorites, dh ein Argument, bei dem zwei Argumente aus einer einzigen Prämisse in einer Kette verbunden sind. Es sei darauf hingewiesen, dass die Verarbeitung von Kettenargumenten beliebig erweitert werden kann, so dass Argumente dieses Typs aus drei oder mehr Einzelargumenten bestehen können.
Die Bewertung eines deduktiven Kettenarguments basiert auf dem bekannten Prinzip, dass eine Kette nur so stark ist wie ihr schwächstes Glied. Somit ist ein deduktives String-Argument genau dann gültig, wenn jedes der String-Argumente gültig ist. In ähnlicher Weise ist ein deduktives Zeichenfolgenargument ungültig, wenn auch nur ein einziges Argument in der Zeichenfolge ungültig ist. Um eine Kette deduktiver Argumente auszuwerten, muss man daher nur jedes Argument in der Kette auswerten. Wenn es ein einzelnes ungültiges Argument findet, wird die Zeichenfolge beschädigt: Die gesamte Zeichenfolge ist ungültig.
Quellen
- Carillo, L. (2007). Normen, Prinzipien und Kommunikationsstrategien .
- Dominguez, S. (1939). Philosophischer Text . Begriffe der Logik, Wissenschaftstheorie (S. 53).
- Königin, E. (1948). Das Abenteuer der Dauphin-Puppe. Aus „Das große Buch der Weihnachtsgeheimnisse“, Teil 13.
- Trujillo, J. und Vallejo, X. (2007). Theoretischer Syllogismus , praktisches Denken und rhetorisch-dialektisches Denken.